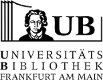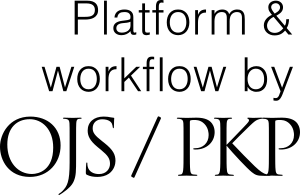„Denn all das geht vorbei. Aber die Kunst bleibt.“
Opportunistische Filmschaffende in Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel (2023)
Abstract
Der Artikel analysiert Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel (2023) mit Blick auf die Inszenierung von Opportunismus und Mitläufertum im Kontext der Filmproduktion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht die literarische Verarbeitung von G. W. Pabst, einem bedeutenden Regisseur der Weimarer Republik, der ab 1939 unter den Bedingungen des NS-Regimes Filme drehte. Durch die Verschmelzung von Fakt und Fiktion wird die moralische Ambivalenz eines Künstlers aufgezeigt, der sich zwischen den Grenzen künstlerischen Schaffens und politischer Anpassung bewegt. Dabei erzeugt der Roman ein Bild, bei dem Pabsts Karriere als geprägt von systembedingten Zwängen erscheint: von den ökonomischen Kompromissen der Weimarer Republik über die Machtlosigkeit in Hollywood bis zur scheinbaren künstlerischen Freiheit im NS-Regime. Dass opportunistische Unterwerfung von moralischen Grenzüberschreitungen begleitet sein kann, legt insbesondere die Produktion des Films Der Fall Molander (1945) nahe, der die letzte Stufe der Eskalation bildet.
Lichtspiel zeigt sich als literarische Reflexion über die Verführbarkeit von Künstler:innen durch autoritäre Systeme. Dabei wirft der Roman die Frage nach der Verantwortung von Künstler:innen und der fehlenden Aufarbeitung solcher Verstrickungen in der Nachkriegsgesellschaft auf.
Keywords
Opportunismus; Künstlerische Freiheit; Nationalsozialismus; Unzuverlässiges Erzählen; Daniel Kehlmann