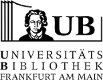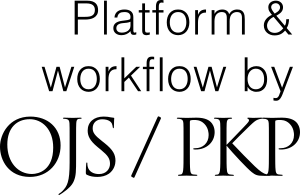Mitläufertum versus Widerstand?
Terry Georges Genozid-Film Hotel Ruanda im Lichte von Steven Spielbergs Schindlers Liste
Abstract
Ausgehend von als ‚Filmklassiker‘ rubrizierten Produktionen, die sich mit – vermeintlich opportunistischem – Verhalten während eines Genozids befassen, möchte ich vergleichende Perspektiven auf die Figur von ‚Rettern‘ und ihrer Benutzung von genozid-konformem Verhalten eröffnen. Es handelt sich zum einen um Spielbergs Film Schindlers Liste, zum anderen um das dem Genozid an den Tutsi gewidmete Oeuvre Hôtel Rwanda. Meine These besagt, dass der letztgenannte Film in direkter Auseinandersetzung mit der Spielberg-Vorlage ist, d.h. zu zeigen versucht, wie ein scheinbares Mitläufertum genutzt wird, um Verfolgten in einem genozidalen Apparat das Leben zu retten.
Nun hat sich jedoch erwiesen, dass das reale Vorbild, das in Hôtel Rwanda den Protagonisten abgibt, in Wirklichkeit kein ‚Gerechter unter den Völkern‘ war, sondern ein Mann, dessen Rolle als durchweg ambivalent zu werten ist. So tritt das Mitläuferische der Erinnerungspraxis hervor, die sich in der Übernahme von Erzählklischees aus Hollywood dokumentiert, zugleich aber auch im Script und der erzählerischen Grundlage des Films selbst liegt. Obwohl mit dokumentarischem Anspruch auftretend, erweist sich die Produktion als Versuch, prospektive Erwartungshaltungen eines an Shoah-Fiktionen gewöhnten Publikums restlos zu befriedigen. Der konformistische Zuschnitt der Handlung – die Zentrierung auf die nur scheinbar zynische Nutzung von bestehenden Kontaktnetzen durch den Protagonisten, die Konzentration auf die Rettung der Kernfamilie, die Darstellung von Gewalt als Mittel zur Herstellung einer voraussehbaren Mustern folgenden ‚Spannung‘, die Ausrichtung am ‚happy-end‘ – korrespondiert also mit zwei Dingen: Erstens soll das ‚Erfolgsrezept‘ von Schindlers Liste für den eigenen Erfolg genutzt werden. Und zweitens soll ein Opportunismus gefeiert werden, der in Wirklichkeit die Macht zu unterlaufen verstehe.
Um das Problematische an diesen Erzählansätzen zu begreifen, wird es nötig sein, Blicke in Autobiographien zu werfen, in denen Überlebende der Katastrophe des Jahres 1994 von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Mord-Apparat berichten. Es wird mithin die Frage zu prüfen sein, ob nicht gerade die Ausrichtung am ökonomischen Erfolg, der in beiden Filmen den ‚Helden‘ ihre lebensrettenden Aktionen möglich gemacht habe, das Topische verstärkt, durch das in Happy-end-Geschichten die Ausnahme zur Regel, die Rettung zum Erfreulich-Optimistischen und der Massentod zum Vergessenswerten erklärt wird.
Keywords
Genozid an den Tutsi Ruandas; Shoah; Genozidvergleich; filmische Erzählmuster über Gewalt; Schindlers Liste; Hotel Ruanda